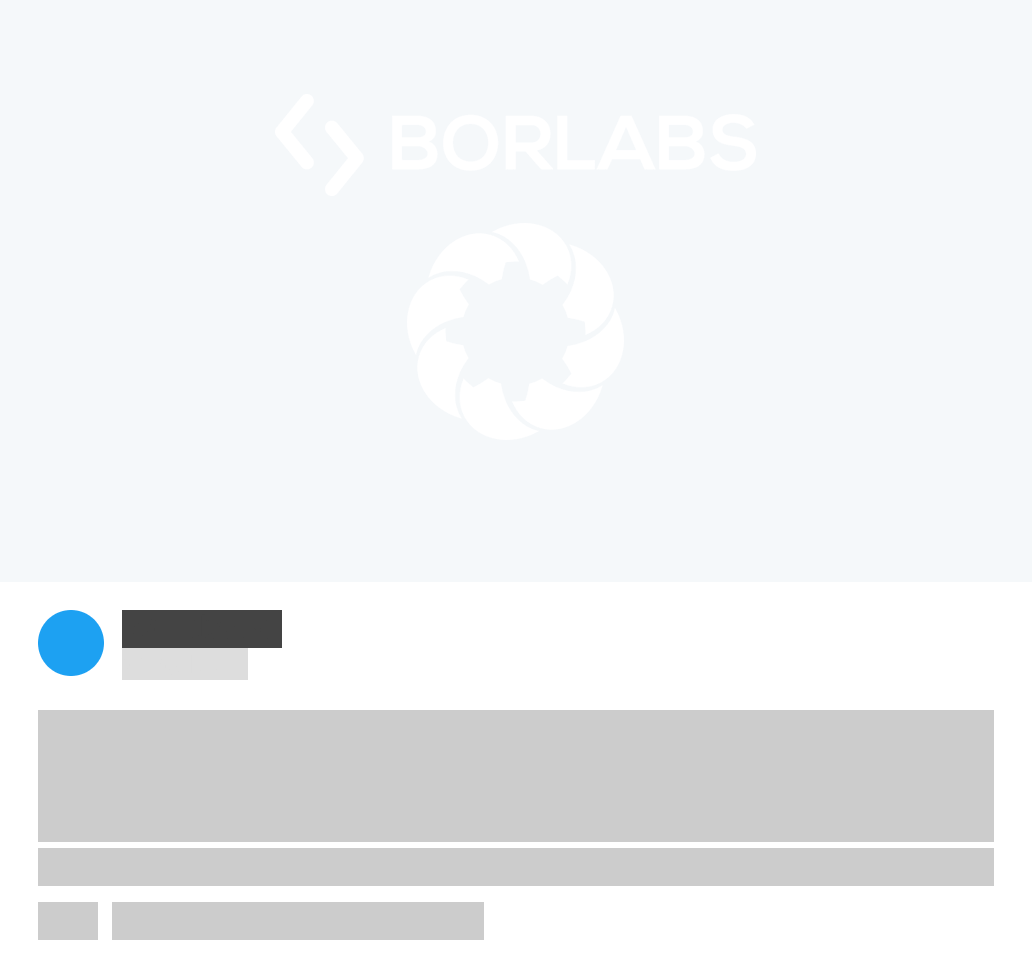Die Berliner SPD befindet sich nicht in einer Krise. Sie befindet sich im Zusammenbruch – organisatorisch, personell, geistig. Was sich gegenwärtig vor den Augen der Öffentlichkeit vollzieht, ist kein gewöhnlicher Machtkampf, sondern der finale Beweis dafür, dass diese Partei ihre historische Funktion verloren hat und nur noch als Hülle eines vergangenen Zeitalters existiert.
Mit 13 Prozent mittlerweile auf Platz fünf.
Und dennoch konzentriert sich die Partei nicht auf Inhalte, nicht auf Lösungen für die reale Notlage dieser Stadt – sondern auf interne Intrigen, Quotenfragen und Personalverschleiß. Eine Organisation, die sich in dieser Lage vor allem mit sich selbst beschäftigt, hat aufgehört, politische Partei zu sein. Sie ist zum Versorgungsapparat ohne Legitimation verkommen.
Der Fall Nicola Böcker-Giannini – nach Michael Müller, nach Franziska Giffey, nach Martin Hikel – ist dabei kein Einzelfall. Er ist Symptom einer kannibalischen Parteikultur, die ihre eigenen Spitzen demontiert, sobald sie nicht mehr in das jeweilige Machtgefüge passen.
„Könige ohne Land“ – Macht ohne Volk, Führung ohne Führung
Raed Salehs zynischer Satz von den „Königen ohne Land“ offenbart mehr Wahrheit, als ihm lieb sein kann. Die Berliner SPD besteht inzwischen aus Funktionären ohne Rückhalt, ohne gesellschaftliche Basis, ohne Volk. Was bleibt, sind Titel ohne Substanz und Ämter ohne Autorität.
Zwischen Parteivorstand und Fraktion, Anspruch und Wirklichkeit und Führung und Gefolgschaft klafft eine unüberwindbare Leere. Der politische Raum, den diese Partei einst füllte – Arbeiter, Angestellte, Mittelstand, kommunale Verankerung, nationale Verantwortung –, existiert für sie nicht mehr. Sie spricht nicht mehr mit der Stadt, sondern nur noch über sich selbst.
Besonders offen trat diese innere Verrottung in Reinickendorf zutage:
Ein Geflecht aus Familie, Loyalitäten und klientelistischen Strukturen entscheidet über Karrieren – nicht Kompetenz, nicht Leistung, nicht politische Idee. Eine Partei, die sich angeblich dem Kampf gegen „Vetternwirtschaft“ und „Klüngelei“ verschrieben hat, vollzieht intern genau das in Reinform: Seilschaften, Netzwerke, Kaltstellung, Disziplinierung.
Doppelspitze als letzter Mythos
Inmitten dieser Erosion wird nun der nächste Mythos aktiviert: die Doppelspitze – nicht als strategische Entscheidung, sondern als ideologisch aufgeladene Beruhigungspille für eine nervöse, zerstrittene Partei.
Steffen Krach soll übernehmen. Aber nicht allein. Nicht, weil Kompetenz geteilt werden soll, nicht, weil unterschiedliche Profile benötigt werden – sondern, weil ein Einzelvorsitzender „nicht mehr zeitgemäß“ sei. Was hier als Fortschritt verkauft wird, ist in Wahrheit Ohnmacht. Die SPD-Frauen fordern eine Co-Vorsitzende. Nicht aus politischer Logik, sondern aus identitär-emanzipatorischer Pflicht. Die linke Parteimehrheit wiederum möchte eine eigene Kandidatin platzieren – idealerweise eine, die Krach kontrollierbar macht oder in Schach hält.
Damit steht der designierte Spitzenkandidat vor einem Dilemma: Entweder er darf selbst wählen – und riskiert innerparteilichen Widerstand. Oder die Partei präsentiert ihm eine Frau – und offenbart offen die Machtverhältnisse hinter der Kulisse. Beide Varianten schwächen ihn. Beide verdeutlichen, dass es hier nicht um Führung geht, sondern um Gleichgewicht innerhalb eines zerfallenden Apparats.
Die Namen, die kursieren – Kiziltepe, Klose und andere – sind dabei nebensächlich. Sie alle stehen für denselben Typus: ideologisch verfestigt, strukturell abhängig, zeitlich überlastet und strategisch hilflos. Die SPD sucht nicht nach Führung – sie sucht nach einer funktionalen Ergänzung für ein zusammenbrechendes System.
Die Partei im Konflikt mit sich selbst
Die Berliner SPD ist heute ein Feld offener Widersprüche:
Sie will Opposition sein und Regierung bleiben
Sie will links sein und pragmatisch wirken
Sie will erneuern und das Alte konservieren
Sie will Vielfalt – und vernichtet abweichende Positionen
So entsteht ein permanenter innerer Bürgerkrieg – zwischen Fraktion und Vorstand, zwischen Parteivettern und Parteitöchtern, zwischen Quote und Realität, zwischen Restmacht und Bedeutungsverlust. Und während Berlin zerfällt – infrastrukturell, sicherheitspolitisch, sozial, wirtschaftlich – diskutiert die SPD darüber, wer wem den Rücken freihalten darf. Diese Partei hat den Kontakt zur Realität nicht nur verloren – sie hält ihn inzwischen für störend.
Vom Niedergang einer Partei zum Niedergang einer Ära
Was hier sichtbar wird, reicht weit über Berlin hinaus. Die SPD in ihrer klassischen Form war eine der tragenden Säulen der Bonner und Berliner Republik: industriell, sozial, national eingebunden, konfliktfähig, aber staatstragend. Heute ist davon nichts mehr übrig. Das gilt im Bund letztlich gleichermaßen.
Die SPD ist zu einer politischen NGO mit Mandaten geworden, losgelöst vom produktiven Teil der Gesellschaft, vom Sicherheitsempfinden der Bürger, von wirtschaftlicher Vernunft, von kultureller Identität. Sie verwaltet nicht mehr Stadt und Land – sie verwaltet nur noch ihren eigenen Bedeutungsverlust. Und genau deshalb ist ihr innerer Zerfall kein Betriebsunfall, sondern historische Notwendigkeit, wovon die Linke profitiert.
Das Ende geschieht nicht leise
Die Berliner SPD wird sich nicht erneuern. Sie wird sich auch nicht stabilisieren. Sie wird weiter schrumpfen, weiter zerfallen, weiter Personal verbrennen – bis sie nur noch als formale Struktur existiert. Was bleibt, sind Rituale, Parteitage, Quoten, Funktionstitel – und irgendwann Erinnerung. Die Berliner SPD ist kein wirklicher Gegner mehr. Sie ist ein Mahnungssymbol des politischen Niedergangs. Und gerade deshalb ist sie so aufschlussreich: In ihrem Zerfall erkennen wir das Ende einer ganzen Epoche.
… Mehr sehenWeniger sehen